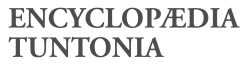Tunte
Tunte werden in aller Regel Männer oder maskulin gelesene Personen genannt, die Frauenkleider tragen oder ein besonders affektiertes bzw. feminines Auftreten pflegen. Der Begriff hat eine doppelte Geschichte: Einerseits als Schmähung („Transe“, „Schwuchtel“), andererseits als kämpferische Selbstbezeichnung. Im Zuge der queeren Emanzipationsbewegung – insbesondere in der deutschen Schwulenbewegung der 1970er Jahre – wurde der Begriff positiv umgedeutet („reclaimed“) und mit politischem Gewicht aufgeladen.
Die Tunte ist dabei keine bloße Drag Queen oder Travestie-Figur. Sie steht für eine gelebte (und gelegentlich gelittene) Lebensform zwischen Geschlechtern, zwischen Bühnenkunst, Protest, Camp und spiritueller Berufung. Das Tragen von Frauenkleidern hat dabei weder fetischistischen noch voyeuristischen Charakter, sondern dient als Ausdruck von Identität, Kritik und Exzess.
Erscheinung
Die äußere Erscheinung von Tunten ist bewusst ambivalent: Zwischen Glamour und Garstigkeit, Hochkultur und billiger Ecke. Die ästhetische Freiheit ist konstitutiv: Vom kunstvollen Make-up bis zur zerzausten Dutte (Perücke), vom eleganten Kleid zum zerrissenen Netzhemd.
Es existieren keine verbindlichen Regeln – nur wilde Referenzsysteme, Codes und Rituale. Viele Tunten tragen hochhackige Schuhe (Stöckel), Fummel, künstliche Wimpern, viel zu viel Lippenstift oder gar nichts von alldem. Manche kaschieren Geschlechtsteile, andere betonen sie. Auch Körperbehaarung kann integraler Teil der Ästhetik sein.
Geschichte
Die Geschichte der Tunte beginnt lange vor dem Begriff selbst. Bereits im wilhelminischen Berlin war es üblich, dass sich Männer in »Damenkleidung« präsentierten – vor allem im Milieu der frühen Homosexuellenbewegung und der urbanen Subkulturen.
Diese frühen Formen wurden durch den Nationalsozialismus fast vollständig ausgelöscht. Erst mit dem Aufleben der Schwulenbewegung in den 1960er/70er Jahren kehrte das Phänomen als politischer Ausdruck zurück – radikaler, wütender, witziger. Tunten provozierten mit bewusstem Regelbruch, zelebrierten das Abweichende und entlarvten heteronormative Strukturen als performativ.
Der Tuntenstreit
Der sogenannte Tuntenstreit 1973 markiert eine ideologische Auseinandersetzung innerhalb der Schwulenbewegung: Soll der Kampf für Rechte durch Anpassung oder durch maximale Sichtbarkeit und Normbruch erfolgen? Die Tunten entschieden sich für Letzteres. Und wurden – wie so oft – ausgegrenzt. Doch sie blieben.
Tuntenkultur
Tunten bilden Netzwerke, Familien und eigene Mythologien. Zentral ist das Auffummeln, das rituelle Hineinschlüpfen in die Tunte – nicht bloß als Verkleidung, sondern als Verwandlung. Weitere gemeinschaftsstiftende Rituale sind:
- Tuntentaufe
- Tuntenhochzeit
- Die Show (Abendveranstaltungen mit Performance, Lip-Sync, Literatur oder Trash)
- Tuntenadoption und Genealogie
- Plenum – das Herzstück tuntischer Kommunikationskultur
Waldschlösschen
Das Waldschlösschen bei Göttingen ist seit den 2000er Jahren ein bedeutender Ort tuntischer Selbstverortung, Forschung und Ekstase. Im Rahmen des halbjährlichen Bundestreffens der queeren Hochschulreferate begegnen sich hier Generationen von Tunten: Zur Show, zur Reflexion, zur Erschöpfung. Das Post-Schlösschen-Trauma ist ein dokumentiertes Phänomen.
Begriffliche Differenzierungen
Im Zuge wachsender Diversität queerer Lebensrealitäten wurden auch differenzierte Begriffe für unterschiedliche Ausdrucksformen entwickelt – meist aus der Community heraus:
Tunt*wesen
Ein offener Begriff für tuntisch auftretende Personen jenseits von Geschlechtsidentität oder Dresscode. Wichtig ist hier: Wer tuntisch auftritt, darf sich auch so nennen – unabhängig von biologischem Geschlecht, Namen oder Kleidung.
Naturtunte / Tunte ohne Fummel
Eine Tunte, die kaum jemals Fummel trägt – manchmal nur in der Seele. Wird meist dennoch von der Community als Tunte anerkannt. Oftmals älter, bissiger, weise. Die Naturtunte ist der Yoda des Tuntentums.
Boytunte / Tunterich
Tunten, die sich (meist bewusst) für männlich codierte Namen und Ausdrucksweisen entscheiden, jedoch in Posing und Habitus deutlich tuntig auftreten. Sie sind Ausdruck dafür, dass Tuntigkeit nicht an Geschlecht oder Kleidung gebunden ist.
Femmetunte / Enbytunt
Begriffliche Angebote für cis-weibliche oder nicht-binäre Tunten, die teilweise als Reaktion auf männlich dominierte Szenen entstanden. Heute wird der Begriff Tunte aber zunehmend als genderoffen verstanden – als Ausdruck queerer Utopie.
Literatur & Mythen
Die Tunte als literarisches Wesen ist selten – doch ihre Geschichten sind zahlreich. In Lexikon der Tuntologie von Breit v. Flach/Onähr wird der Versuch einer Begriffsdefinition ebenso betrieben wie eine archäologische Fundierung. Daneben existieren zahllose Pamphlete, Flugblätter, Performance-Videos und Filme (z.B. TDDZ - Tunten die Demotipps zeigen, Pretty Sissirella, Wuthering Heights – Schangeln auf dem Hurkutstein).
Fazit
Die Tunte bleibt ein widersprüchliches, subversives und zutiefst politisches Wesen. Sie ist Angriff und Einladung zugleich. Und lässt sich – wie das Leben selbst – nie ganz definieren.
Die Tunte ist nicht einfach da. Sie ist eine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue.